
(1849-1927 )
Joseph Belli (1849-1927), einem aus Offenburg stammenden Schuhmacher, kommt unter dem „Sozialistengesetz“ eine zentrale Rolle als „Roter Postillon“ zu: Vom schweizerischen Kreuzlingen aus steuert er den Transport und die Verbreitung des Parteiorgans „Der Sozialdemokrat“ sowie anderer illegaler Schriften im Reich. Nachdem 1890 das „Sozialistengesetz“ gefallen ist, arbeitet er für den Stuttgarter Dietz-Verlag.

(1873-1930 )
Die Mannheimerin Therese Blase (1873–1930) hat als die „Grande Dame der badischen Sozialdemokratie“ zu gelten. Um 1905 beginnt die Frau eines Kupferschmieds die proletarische Frauenbewegung in Baden aufzubauen. Seither ist sie vielfältig sozialpolitisch aktiv. Nachdem Blase 1912 als erste Frau in den Landesvorstand der badischen SPD eingerückt ist, vertritt sie ihre Partei von 1919 bis zu ihrem Tod auch im Landesparlament.

(1866–1933 )
Die Schriftstellerin Anna Blos (1866–1933) ist die wohl bekannteste und wichtigste weibliche Politikerin der württembergischen SPD vor 1933. Als Frauenpolitikerin profiliert sie sich ebenso wie als Mitglied des württembergischen SPD-Landesvorstands. 1919 rückt die Ehefrau von Wilhelm Blos als einzige Frau aus ganz Südwestdeutschland in die Weimarer Nationalversammlung ein.

(1849–1927 )
Der Schriftsteller Wilhelm Blos (1849–1927) aus dem badischen Wertheim kann seit 1877 mehrfach für die Sozialdemokratie Reichstagsmandate erringen. Einen Namen macht er sich freilich vor allem als Herausgeber des Satireblatts „Der Wahre Jacob“ und als Verfasser leicht verständlicher Geschichtswerke. 1918 wird der fast 70-Jährige zum Vorsitzenden der württembergischen Revolutionsregierung, 1919 sodann zum ersten Staatspräsidenten des Landes Württemberg ernannt.

(geb. 1927 )
Heinz Bühringer (geb. 1927) beginnt seine politische Karriere als Bürgermeister von Bittenfeld. Seit 1959 gehört er der SPD an. Von 1968 bis 1973 ist er als Nachfolger von Walter Krause Landesvorsitzender der baden-württembergischen SPD. Im baden-württembergischen Landtag, dem er seit Juni 1964 angehört, ist er von 1968 bis 1972 Vorsitzender der SPD-Fraktion. 1980 scheidet Bühringer mit Ende der Legislaturperiode aus dem Landtag aus.
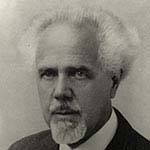
(1875–1946 )
Artur Crispien (1875–1946) aus Königsberg fungiert 1918/19 kurzfristig für die USPD als Innenminister von Württemberg und hernach als Landtagsabgeordneter. Nach der Fusion von USPD und KPD 1920 an die Spitze der Rest-„Unabhängigen“ gerückt, führt er diese 1922 in den Schoß der Mutterpartei zurück. Neben Hermann Müller und Otto Wels bekleidet er seither das Amt des SPD-Reichsvorsitzenden. 1933 gelingt ihm die Flucht in die Schweiz.

(1908–1992 )
Der junge Parteijournalist Max Diamant (1908–1992) wechselt 1931 von der SPD zur SAP und wird deren Bezirksleiter für Baden. Als Grenzsekretär, Mitglied der SAP-Auslandsleitung und SAP-Repräsentant in Barcelona nimmt er im Exil führende Rollen ein, bevor er 1941/42 nach Mexiko entkommt. 1961 kehrt er auf Drängen seines Freundes Willy Brandt von dort nach Deutschland zurück, um für die IG Metall zu arbeiten.

(1843-1922 )
Nach seiner Ausweisung aus Hamburg zieht der Schriftsetzer Johann Heinrich Wilhelm Dietz (1843–1922) im Jahr 1880 ins freiere Stuttgart und gründet dort einen Verlag. Noch unter dem „Sozialistengesetz“ kann sich J. H. W. Dietz als das führende Verlagshaus für sozialdemokratische Presse und Literatur etablieren. Zugleich vertritt der Verleger seine Partei 37 Jahre lang im Reichstag – allerdings nicht für Stuttgart, sondern für Hamburg.

(1844-1906 )
August Dreesbach (1844–1906) firmiert über vier Jahrzehnte lang – von der Mitte der 1870er Jahre bis zu seinem Tod – als der unangefochtene Führer der badischen Sozialdemokratie. 1874 vom ADAV als Agitator nach Mannheim entsandt, zieht er schon vier Jahre später ins örtliche Gemeindeparlament, 1884 in den Stadtrat und schließlich 1890/91 auch in den Reichstag und in den badischen Landtag ein.
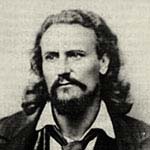
(1819-1884 )
Nach einem bewegten Vorleben hat sich der Königsberger Literat Albert Dulk (1819–1884) 1858 in Stuttgart niedergelassen. Bald nach der Reichsgründung schließt er sich dem ADAV an. Seither ist er führend am Aufbau der württembergischen Sozialdemokratie beteiligt, für die er mehrfach auf Reichs- und Landesebene kandidiert – und für die er nach 1878 auch mehrfach Haftstrafen verbüßen muss.

(geb. 1943 )
1972 zieht Herta Däubler-Gmelin (geb. 1943) für Tübingen in den Bundestag ein, von 1983 bis 1993 fungiert sie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. 1988 wird mit ihr erstmals eine Frau zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. In der rot-grünen Koalitionsregierung übt sie seit 1998 das Amt der Bundesjustizministerin aus, bis sie sich 2002 aus dem Amt zurückzieht. 2009 kandidiert Däubler-Gmelin nach 37-jähriger Zugehörigkeit nicht mehr für den Bundestag.

(1871–1925 )
Im Alter von 17 Jahren verlässt der Heidelberger Sattlerlehrling Friedrich Ebert (1871–1925) seine Heimatstadt, um auf Wanderschaft zu gehen. Just im nahen Mannheim kommt er erstmals in Kontakt mit der sozialdemokratischen Bewegung. Von Bremen aus steigt Ebert 1905 erst in den Reichsvorstand und 1913 dann in den Vorsitz der Partei auf, bevor er 1918/19 als jeweils erster Demokrat an der Spitze von Reichsregierung und Staat das ruinöse Erbe des deutschen Kaisertums zu gestalten sucht.

(geb. 1927 )
Im Frühjahr 1969 – noch zur Zeit der Großen Koalition – folgt der Freiburger Juraprofessor Horst Ehmke (geb. 1927) Gustav Heinemann im Amt des Bundesjustizministers nach. In der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt fungiert er zunächst als Minister für besondere Aufgaben, später als Forschungs- und zuletzt bis 1974 als Postminister. Von 1977 bis 1990 wirkt er als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.

(1815-1849 )
Als Redakteur der „Mannheimer Abendzeitung“ wirkt der gebürtige Feuerbacher Ernst Elsenhans (1815–1849) schon in den Jahren des Vormärz für die radikaldemokratische Sache. Im Juli 1848 zu Arbeitshaus und Festungshaft verurteilt, wird er im Zuge der Mairevolution 1849 befreit. Wegen seiner im „Festungs-Boten“ veröffentlichten Anschauungen wird er nach der Einnahme Rastatts hingerichtet.

(geb. 1926 )
Der Gymnasiallehrer Erhard Eppler (geb. 1926) aus Ulm wechselt 1956 mit Gustav Heinemann von der GVP zur SPD und zieht bereits fünf Jahre später in den Bundestag ein. Seit 1968 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, tritt er 1974 vom Amt zurück. 1976 schließlich wechselt er – unterdessen SPD-Landesvorsitzender – in den Landtag. Seit 1975 übt Eppler darüber hinaus mehr als anderthalb Jahrzehnte lang den Vorsitz in der SPD-Grundwertekommission aus.

(1913–1967 )
Von sechsjähriger KZ-Haft nicht gebrochen, strandet der gebürtige Berliner Fritz Erler (1913–1967) nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes in Südwürttemberg, wo er sich umgehend wieder für die SPD engagiert. Auf Bundesebene rasch zum engsten Führungskreis seiner Partei gehörend, tritt Erler 1964 an die Spitze der SPD-Bundestagsfraktion. 1966 muss er das Amt wegen eines schweren Krebsleidens aufgeben, an dem er schon im Folgejahr stirbt.

(1882–1967 )
Als eine von nur vier Sozialdemokratinnen zieht die Karlsruherin Kunigunde Fischer (1882–1967) im Jahr 1919 in die badische Nationalversammlung ein, und erst die Nazis werden sie 1933 wieder aus dem Landesparlament verjagen. Nach der NS-„Machtergreifung“ 1933 kurzzeitig in „Schutzhaft“ genommen, vertritt Fischer die SPD nach Kriegsende noch 13 Jahre lang im Karlsruher Gemeinderat.

(1874–1914 )
Aus dem südbadischen Nonnenweier nach Mannheim verschlagen, profiliert sich der Jurist Ludwig Frank (1874–1914) ab 1904 im badischen Landtag als entschiedener Vorkämpfer von Großblock- und Budgetbewilligungspolitik. Seit 1907 auch Mitglied des Reichstags, kämpft er innerhalb wie außerhalb der Parlamente für den Friedenserhalt. Im August 1914 meldet er sich dennoch freiwillig an die Front – und stirbt einen Monat später.

(1858–1944 )
Anton Geiß (1858–1944), ein aus dem Allgäu stammender Schreiner, gehört von 1895 bis 1903 und dann wieder seit 1909 dem badischen Landtag an. Noch während des Kaiserreichs bringt es der Sozialdemokrat in diesem Gremium bis zum Vizepräsidenten. Im November 1918 zum Vorsitzenden der vorläufigen Volksregierung Badens ernannt, fungiert er 1919/20 als erster badischer Staatspräsident.

(1811-1881 )
Friedrich Hecker (1811–1881) aus Eichtersheim im Kraichgau ist seit 1838 als Rechtsanwalt in Mannheim tätig. Seit 1842 gehört er der Zweiten Kammer der Badischen Ständever- sammlung an, in der er in der Folgezeit zum Wortführer der radikalen Demokraten avanciert. Nachdem sein im April 1848 unternommener Freischarenzug gescheitert ist, flieht Hecker über die Schweiz in die USA, wo er später auf Seiten der Unionisten am Sezessionskrieg teilnimmt.

(1817-1875 )
Seit den frühen 1840er Jahren pflegt der Dichter Georg Herwegh (1817–1875) aus Stuttgart lebhafte Kontakte zur gesamten linken Szene Deutschlands. Im Frühjahr 1848 am Hecker-Zug beteiligt, gehört er 15 Jahre später zu den Gründungsmitgliedern des ADAV und erlangt als Dichter des „Bundeslieds“ internationale Berühmtheit.

(1864–1935 )
Der aus dem Kraichgau stammende Schriftsetzer Karl Hildenbrand (1864–1935) wirkt seit 1892 als Redakteur der „Schwäbischen Tagwacht“. 1900 wird er ins württembergische Parlament und 1903 in den Reichstag gewählt, dem er mit kurzer Unterbrechung bis 1932 angehört. Im späten Kaiserreich zählt Hildenbrand zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der württembergischen SPD, seit 1911 hat er kurz auch den Vorsitz der Landespartei inne.

(geb. 1926 )
Selber schwer kriegsversehrt, engagiert sich Walter Hirrlinger (geb. 1926) zunächst beim Verband deutscher Kriegsopfer, bevor er zur SPD kommt. Von 1966 bis 1968 hat er den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion inne. Im zweiten Kabinett Filbinger amtiert er von 1968 bis 1972 als Landesminister für Arbeit und Soziales. Von 1990 bis 2008 fungiert er als Präsident des VdK, der unter seiner Ägide zum Sozialverband VdK umgebaut wird.

(1870–1968 )
Als SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag nimmt der langjährige Parteiredakteur, Landtags- und Reichstagsabgeordneten Wilhelm Keil (1870–1968) während der Zeit der Weimarer Republik eine Schlüsselrolle innerhalb der württembergischen Sozialdemokratie ein, auf Reichsebene gibt er maßgebliche finanzpolitische Impulse. Hoch betagt fungiert er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Präsident des Landtags von Württemberg-Baden.
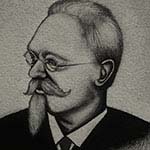
(1847-1908 )
Schon in der ersten Hälfte der 1870er Jahre im Stuttgarter Tischlerbund aktiv, steht der Schreiner Karl Kloß (1847–1908) seit den 1880er Jahren an der Spitze des Deutschen Tischler- bzw. Holzarbeiterverbands und später auch des internationalen Berufsverbands. In und für Stuttgart nimmt er wichtige politische Ämter ein, 1898 ist er der Erste, der für die württembergische SPD in den Reichstag einziehen kann.

(1870–1918 )
Wilhelm Kolb (1870–1918) hat als einer der klügsten Köpfe der badischen Sozialdemokratie im späten Kaiserreich zu gelten. Nachdem der Redakteur des Karlsruher Parteiorgans „Volksfreund“ 1905 in den badischen Landtag eingezogen und erst recht, nachdem er bald darauf zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden ist, betreibt er im Landesparlament eine pragmatische und zugleich kraftvolle Politik. Das Kriegsende erlebt Kolb nicht mehr: Im April 1918 stirbt er im Alter von nur 57 Jahren.

(1912–2000 )
1952 rückt Walter Krause (1912–2000) als jüngstes Mitglied ins Parlament des neu gegründeten Landes Baden-Württemberg ein, das er erst 1980 wieder verlassen wird. 1966 schmiedet der nunmehrige Partei- und Fraktionsvorsitzende die erste Große Koalition auf Landesebene, 1968 führt er sie gegen den Willen einer Parteitagsmehrheit in eine zweite Runde. Als Landesinnenminister stemmt Krause die Große Kreisreform, mit der er als „Architekt Baden-Württembergs“ in die Landesgeschichte eingehen soll.

(geb. 1928 )
Ulrich Lang (geb. 1928) kommt wie Erhard Eppler von der Gesamtdeutschen Volkspartei zur SPD. Seit 1972 gehört er dem baden-württembergischen Landtag an. Nach dem Rückzug Epplers übernimmt er 1980 den Vorsitz der SPD-Fraktion und 1981 den der Landespartei. Bei der Landtagswahl 1984 tritt Lang als Spitzenkandidat gegen Ministerpräsident Späth an. Nach dem schlechten Abschneiden der Südwest-SPD bei der Bundestagswahl 1987 gibt er den Landesvorsitz ab, den Fraktionsvorsitz legt er nach der Landtagswahl 1988 nieder.

(1891–1945 )
Geboren im elsässischen Biesheim, besucht Julius Leber (1891–1945) die Schule im benachbarten Breisach. 1912 tritt er der SPD bei und nimmt ein Studium in Straßburg auf, später wechselt er nach Freiburg. Im Krieg nach Norddeutschland verschlagen, vertritt er die Lübecker SPD seit 1924 im Reichstag und exponiert sich zunehmend im Abwehrkampf gegen ganz rechts wie ganz links. Nach der NS-„Machtergreifung“ bezahlt er seinen Einsatz mit langer Gefängnis- und KZ-Haft und 1945 schließlich mit dem Leben.

(1880–1962 )
Der Gewerkschaftssekretär Philipp Martzloff (1880–1962) gehört zu den führenden Persönlichkeiten der südbadischen Sozialdemokratie in Weimarer Republik und früher Nachkriegszeit. 1918/19 fungiert der Freiburger als badischer Sozialminister, bis 1933 gehört er dem badischen Landtag an. Von Verfolgung und KZ-Haft nicht gebrochen, ist er nach Kriegsende als Präsident des Landesarbeitsamts Baden und in anderen Funktionen führend am Wiederaufbau beteiligt.
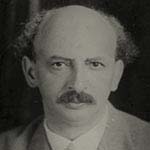
(1882–1934 )
Der Rechtsanwalt Ludwig Marum (1882–1934) vertritt die SPD seit 1914 im badischen Landtag. 1918/19 zunächst zum Justizminister berufen, steht der gebürtige Pfälzer hernach knapp ein Jahrzehnt lang an der Spitze der badischen Landtagsfraktion, bevor es ihn 1929 in den Reichstag zieht. Als „Marxist“ jüdischer Herkunft doppelt im Visier der Nazi-Brut, wird er 1934 im KZ Kislau von SS- und SA-Schergen erdrosselt.

(geb. 1948 )
Ulrich Maurer (geb. 1948) gehört seit 1980 dem Landtag von Baden-Württemberg an, von 1992 bis 2001 bekleidet er das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Von 1987 bis 1999 ist er zudem Vorsitzender der baden-württembergischen SPD. 2005 tritt er aus der SPD aus und setzt sein politisches Wirken bei der WASG sowie ab 2007 bei der Partei Die Linke fort, die er von 2005 bis 2013 im Bundestag vertritt.

(1838-1907 )
Julius Motteler (1838–1907) gehört zu den führenden deutschen Sozialdemokraten der ersten Generation. Seit 1869 hat er den Vorsitz der Internationalen Gewerksgenossenschaft der Manufaktur-, Fabrik- und Handarbeiter inne. Im selben Jahr gründet er mit August Bebel, Wilhelm Liebknecht und anderen die SDAP. Schon fünf Jahre später rückt er für seine Partei erstmals in den Reichstag ein.

(1903–1985 )
„Genosse Generaldirektor“ lautet der Spitzname des SPD-Politikers Alex Möller (1903–1985). Von 1946 bis 1961 gehört er den Landesparlamenten von Württemberg-Baden und Baden-Württemberg an, seit 1950 fungiert er als Fraktionsvorsitzender. 1961 wechselt Möller in den Bundestag, im Jahr darauf wird er zum Landesvorsitzenden der Südwest-SPD gewählt. Als erster Finanzminister der sozialliberalen Koalition kämpft er für einen rigiden Sparkurs. Als er diesen nicht durchsetzen kann, tritt er im Mai 1971 von seinem Ministeramt zurück.

(1876–1931 )
Der gebürtige Mannheimer Hermann Müller (1876–1931) gehört zu den Schlüsselfiguren der Weimarer Republik: Zusammen mit Otto Wels steht er ab 1919 an der Spitze sowohl der Reichs-SPD als auch der Nationalversammlungs- und Reichstagsfraktion. Als Außenminister muss er im selben Jahr den Versailler Vertrag unterzeichnen, als Reichskanzler setzt er zwischen 1928 und 1930 die Räumung des besetzten Rheinlands und eine deutliche Verringerung der deutschen Reparationszahlungen durch.

(1885–1946 )
Bevor Georg Reinbold (1885–1946) sieben Jahre lang als Sopade-Grenzsekretär unter widrigsten Umständen den SPD-Widerstand im gesamten deutschen Südwesten anleitet und organisiert, hat er in Baden maßgebliche politische Positionen ausgefüllt – so seit 1924 als SPD-Landesvorsitzender und als Vizepräsident des Landtags. 1940/41 kann er sich über Portugal in die USA retten, wo er 1946 entkräftet stirbt.

(1877–1951 )
Als langjähriger badischer Innenminister und zeitweilig auch als badischer Staatspräsident gestaltet der gelernte Müller Adam Remmele (1877–1951) die badische Politik der Weimarer Zeit an vorderster Stelle mit, demokratisiert die Landespolizei, gibt aber auch der Reichsreformdebatte wichtige Impulse. Vor wie nach der NS-Zeit kommt ihm darüber hinaus eine maßgebliche Rolle in der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung zu.

(1884–1953 )
Als Vorsitzender der Landespartei und Reichstagsabgeordneter hat der „Tagwacht“-Redakteur Erich Roßmann (1884–1953) spätestens seit 1924 eine Schlüsselfunktion in der württembergischen SPD inne. 1933 und dann wieder 1944 in KZ-Haft, bekleidet er nach Kriegsende als Generalsekretär des Süddeutschen Länderrats und als Intendant von Radio Stuttgart abermals wichtige Funktionen.

(1844-1918 )
Im Frühjahr 1869 sucht der Jurastudent Philipp August Rüdt (1844–1918) ein Organ der „sozial-democratischen Partei“ für das Gebiet der ehemaligen Kurpfalz zu etablieren. Kurz darauf wechselt der vom Volksstaatsgedanken beseelte junge ADAV-Agitator zur neu gegründeten SDAP. Ab 1891 gibt Rüdt ein kurzes Gastspiel im badischen Landtag, bevor er sich endgültig mit seiner Partei überwirft und sich vollends aus der Politik zurückzieht.

(1907–1997 )
Die Fürsorgerin Marta Schanzenbach (1907–1997) aus Gengenbach zieht 1949 als eine von vier Frauen in den ersten Deutschen Bundestag ein, dem sie bis 1972 angehören wird. Als erste Frau wird sie 1958 in den SPD-Bundesvorstand und ins Präsidium der Partei gewählt. Zudem fungiert sie als Vorsitzende des Bundesfrauenausschusses der SPD, den sie selbst mitbegründet hat.

(1944–2010 )
Hermann Scheer (1944–2010) engagiert sich lange bei den Jusos, so unter anderem als stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender. Im Bundestag, dem er seit 1980 angehört, vertritt er für die SPD zunächst die Bereiche Abrüstung und Rüstungskontrolle. Sein Engagement für den Ausbau erneuerbarer Energien wird 1999 mit dem Alternativen Nobelpreis honoriert. Im darauf folgenden Jahr leitet er mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz einen nachhaltigen Kurswechsel in der Energiepolitik ein. 2010 stirbt Scheer überraschend in Berlin.

(1896–1979 )
Carlo Schmid (1896–1979) hat als führender Vordenker der Nachkriegs-SPD und als einer ihrer einflussreichsten Parteireformer zu gelten. Nach seinem Parteibeitritt 1945 gelangt er quasi aus dem Stand heraus an die Spitze des Landesverbands Württemberg-Hohenzollern. Als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Parlamentarischen Rat sowie als langjähriger Bundestagsabgeordneter prägt er die deutsche Nachkriegspolitik an vorderster Stelle mit.

(geb. 1973 )
Nachdem Nils Schmid (geb. 1973) im Jahr 2009 zum Landesvorsitzenden der SPD Baden-Württemberg gewählt worden ist, tritt er bei der Landtagswahl 2011 auch als Spitzenkandidat seiner Partei an. Im grün-roten Koalitionskabinett von Winfried Kretschmann fungiert er seither als Minister für Finanzen und Wirtschaft sowie als stellvertretender Ministerpräsident.

(1899–1976 )
Erwin Schoettle (1899–1976) leitet nach seiner Flucht aus Deutschland sechs Jahre lang das Sopade-Grenzsekretariat im schweizerischen St. Gallen. Als langjähriger SPD-Landesvorsitzender nimmt er nach 1945 Schlüsselpositionen in der Landespolitik ein, an der Spitze der SPD-Fraktion im Wirtschaftsrat der Bizone und als Vizepräsident des Deutschen Bundestags desgleichen auch auf nationaler Ebene.

(1878-1937 )
Die Reutlinger Weberin Laura Schradin (1878–1937) ist schon in jungen Jahren in SPD und Gewerkschaft aktiv. Als Begründerin der proletarischen Frauenbewegung Württembergs ist sie darüber hinaus vielfältig sozial engagiert. Von 1919 bis 1924 gehört sie dem württembergischen Landtag an. Obwohl sie Mitte der 1920er Jahre der SPD den Rücken gekehrt hat, wird sie 1933 kurzfristig in „Schutzhaft“ genommen.

(1895–1952 )
1920 kommt der Westpreuße Kurt Schumacher (1895–1952) als Redakteur zur „Schwäbischen Tagwacht“. 1924 in den württembergischen Landtag und 1930 in den Reichstag gewählt, bietet der Vorsitzende der Stuttgarter Parteisektion den Nazis innerhalb wie außerhalb der Parlamente Paroli. Nach Kriegsende sieben Jahre lang unangefochten an der Spitze seiner neu aufgebauten Partei stehend, erliegt er 56-jährig den in der NS-Zeit während mehr als zehnjähriger Haft erlittenen Torturen.

(1938–2013 )
Harald B. Schäfer (1938–2013) wird 1972 erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt. Zunächst beschäftigt er sich dort mit der Innenpolitik, wozu damals auch die Umweltpolitik zählt. Schon früh engagiert er sich innerhalb der SPD gegen die Atomkraft und streitet für eine ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft. 1992 wird er Umweltminister in der Großen Koalition in Stuttgart. Nach deren Abwahl 1996 zieht er sich aus der aktiven Politik zurück.
Er stirbt im Januar 2013 nach langer Krankheit.

(geb. 1943 )
Dieter Spöri (geb. 1943) gehört von 1975 bis 1998 dem Landesvorstand der baden-württembergischen SPD und von 1988 bis 1998 dem SPD-Bundesvorstand an. Von 1976 bis 1988 ist Spöri Bundestagsabgeordneter, bevor er in die Landespolitik wechselt. In der Großen Koalition von 1992 bis 1996 übernimmt er das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers. Es folgen Tätigkeiten in der Wirtschaft. Von 2006 bis 2012 ist Spöri zudem Präsident des Netzwerks Europäische Bewegung Deutschland.

(1824-1862 )
Die gebürtige Mannheimerin Amalie Struve (1824-1862) gehört zu den frühesten Frauenrechtlerinnen Deutschlands. 1848 ist sie aktiv erst am Hecker-Zug und sodann an dem von ihrem Ehemann Gustav Struve unternommenen Putsch beteiligt, was ihr eine mehrmonatige Gefängnishaft einträgt. Im US-Exil setzt Amalie Struve ihren Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen publizistisch fort. Im Alter von erst 37 Jahren stirbt sie 1862 in New York an den Folgen einer Geburt.
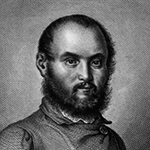
(1805-1870 )
Gustav Struve (1805–1870), ein seit 1836 in Mannheim tätiger Rechtsanwalt und Publizist, hat als einer der Vordenker der badischen Radikaldemokratie zu gelten. Nach einem zweiten Putschversuch im September 1848 inhaftiert, wird Struve im Mai 1849 befreit und avanciert zum Mitglied der badischen Revolutionsregierung. Nach der endgültigen Niederschlagung der Revolution flieht er über die Schweiz und England in die USA.
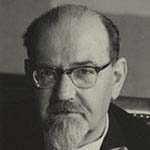
(1888–1969 )
Der Buchdrucker Fritz Ulrich (1888–1969) gehört seit 1919 dem württembergischen Landesparlament und seit 1930 auch dem Reichstag an. In der NS-Zeit mehrfach inhaftiert, nimmt er nach Kriegsende als Innenminister erst des Landes Württemberg-Baden und dann des neu gegründeten Landes Baden-Württemberg sowie als Vorsitzender des SPD-Landesverbands eine Schlüsselrolle in der südwestdeutschen Landespolitik ein.

(1897–1973 )
1945 von der US-amerikanischen Besatzungsmacht als Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt Karlsruhe eingesetzt, fungiert Hermann Veit (1897–1973) seit 1946 als Wirtschaftsminister und seit 1951 auch als stellvertretender Ministerpräsident des Landes Württemberg-Baden. Auch im 1952 gegründeten Südweststaat bekleidet er beide Funktionen noch lange. Veit ist damit in den 1950er Jahren der „starke Mann“ der Südwest-SPD.

(geb. 1964 )
Mit Ute Vogt (geb. 1964) steht seit 1999 erstmals eine Frau an der Spitze der Südwest-SPD. Seit 1994 Bundestagsabgeordnete, fungiert sie darüber hinaus von 2002 bis 2005 als Parlamentarische Staatssekretärin des Inneren. Bei der Landtagswahl 2001 erreicht die Partei unter Vogts Ägide ihr bestes Ergebnis seit 1972. Sie selbst zieht 2006 in den Landtag ein und übernimmt den Fraktionsvorsitz. 2008 gibt sie das Amt wieder ab, im Folgejahr verzichtet sie auf den Landesvorsitz und wendet sich erneut der Bundespolitik zu.

(1891–1969 )
Hedwig Wachenheim (1891–1969) hat 1919 in Berlin die AWO mitbegründet und später fünf Jahre lang dem Preußischen Landtag angehört. Die Flucht vor politisch-rassischer Verfolgung führt sie über Frankreich und Großbritannien 1935 schließlich in die USA, wo sie 1939 zu den Mitbegründerinnen und Mitbegründern der „German Labour Delegation“ gehört.

(1857-1933 )
Schon 1878 ist Clara Zetkin (1857–1933) der SAP beigetreten. Nach ihrer Rückkehr aus zehnjähriger Emigration seit 1890 in Sillenbuch bei Stuttgart lebend, wirkt sie seit 1892 als Redakteurin des in Stuttgart herausgegebenen SPD-Organs „Die Gleichheit“. Erst ihr Wechsel zur USPD 1917 macht dem ein Ende. In der Weimarer Republik gehört Zetkin zur Führungsriege der KPD. Sie stirbt im sowjetischen Exil.

(1888–1949 )
Nachdem Gustav Zimmermann (1888–1949) schon vor 1933 zum engeren Führungspersonal der badischen SPD gehört hat, fungiert er nach Kriegsende als Landesdirektor des Inneren für Nordbaden sowie als Co-Vorsitzender des württembergisch-badischen SPD-Landesverbands. Im Parlamentarischen Rat steht er Carlo Schmid als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zur Seite.